Von dem rotbraunen Metall Kupfer werden mehr als 20 Millionen Tonnen jedes Jahr verarbeitet: Sowohl Kupfer als auch Kupferoxid sind Standardmaterialien für elektrische Kabel und für Münzen. Als aktiver Bestandteil sind sie in Biozidprodukten (z.B. in Holzschutzmitteln und Antifouling-Farben) enthalten. Kupferoxid findet sich außerdem wegen seiner antimikrobiellen Eigenschaften in verbrauchernahen Produkten wie Kissenbezügen oder Socken. Kupfer ist aber auch ein essenzielles Spurenelement, unentbehrlich für wichtige Enzyme im menschlichen Körper. Erwachsene Menschen sollten täglich ca. 1 – 1.5 mg davon aufnehmen.
Wie könnte ich damit in Kontakt kommen?

Kupferrohre © axe olga / fotolia.com
Die Wahrscheinlichkeit einer Aufnahme von Kupfer über die Haut, wenn man z.B. Geldmünzen anfasst, wird als sehr niedrig eingestuft. Arbeiter in Metall verarbeitenden Fabriken könnten andererseits durch das Einatmen von Kupferoxid-Dämpfen bei Schmelzvorgängen das sogenannte Metallfieber bekommen. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung mit Symptomen, die einer Grippeinfektion gleichen. Allerdings enthalten auch Vitamintabletten oder ähnliche Produkte Kupferoxid als eine sichere Quelle zur Kupferergänzung. Es sollte jedoch unbedingt vermieden werden, ein Übermaß dieser Präparate einzunehmen.
Wie gefährlich ist das Material für Mensch und Umwelt?
Nach Verschlucken von Kupferoxidpulver oder auch Einatmen der Dämpfe können gesundheitliche Effekte wie Übelkeit, Brechdurchfall oder dunkler Stuhl beim Menschen auftreten. Allerdings sind diese Symptome nur nach hohen Dosen zu beobachten – und auch nur, wenn sich das Kupfer aus dem Kupferoxid herauslöst, wodurch es bioverfügbar wird. Dennoch ist Kupfer ein essenzielles Spurenelement, das für die normalen Funktionen des Körpers notwendig ist, z.B. für das Nervensystem, das Immunsystem, das Herz und die Haut sowie für die Bildung neuer Gefäße. Kupfer kann sehr gut vom menschlichen Körper verarbeitet werden, wobei einige Tierarten wesentlich empfindlicher auf die Kupfer-Toxizität reagieren.
Fazit
Im täglichen Leben haben wir nahezu ständig Kontakt mit Kupfer oder Kupferoxid, da es in vielen Produkten enthalten ist. Auch wenn Kupfer ein essenzielles Spurenelement ist, sollte nicht vergessen werde, dass es in Überdosierung auch zu Hautreizungen führen kann. Die Handhabung von Kupfer speziell von Kupferoxidpulvern (z.B. Nanopestizide) sollte daher sehr vorsichtig geschehen.
Eigenschaften und Anwendungen
Kupfer ist eines der weltweit wichtigsten Industriemetalle. Mehr als 20 Millionen Tonnen des Schwermetalls werden jährlich verbraucht. Diese hohe Nachfrage, die insbesondere durch das industrielle Wachstum Asiens getrieben ist (62% des weltweiten Kupferverbrauchs entfallen auf Asien), verdankt es seinen hervorragenden Eigenschaften.

Elektrokabel © Mirko Graul / fotolia.com
Denn es findet vor allem als hervorragender Wärme- und Stromleiter vielseitige Verwendung. Zwar leiten bspw. Silber und Gold Strom ähnlich gut, sind jedoch deutlich teurer. Aluminium gar leitet Strom besser als Kupfer, ist jedoch problematischer zu verarbeiten und im Gegensatz zu Kupfer nicht so reaktionsträge. Dies führte dazu, dass Kupfer das unangefochtene Standardmaterial für elektrische Leitungen ist. Es kommt in nahezu allen Stromkabeln, Transformatoren, Schaltern, Prozessoren u.ä. Produkten vor.
Auch Erneuerbare Energien kommen nicht ohne die exzellente Leitfähigkeit des Kupfers aus. Mit zunehmender Elektrifizierung unserer Transportmittel (Auto, Bahn, Flugzeug) steigen auch hier die Anwendungen für Kupfer. Hochgeschwindigkeitszüge, wie der ICE 3 beispielsweise, benötigen 2 bis 4 Tonnen Kupfer - die mehr als doppelte Menge des normalen elektrisch betriebenen Zuges.
Im Baubereich ist Kupfer ebenfalls ein beliebter Rohstoff: Nahezu 60 Prozent aller deutschen Häuser haben Wasserrohre aus Kupfer. Zudem findet es als Dachmaterial Einsatz und ist beliebt aufgrund seiner Beständigkeit gegen extreme Witterungsbedingungen. Kupfer bildet in Anwesenheit von Luft eine grüne Patina auf der Oberfläche aus, einem jeden von uns sind solche Dächer insbesondere von älteren Gebäuden bekannt.
Neben der Anwendung als Münzmetall ist Kupfer der derzeit am meisten verwendete Biozidwirkstoff. Als solche Substanz wird es in Antifouling-Anstrichen von Schiffen genutzt. Hierdurch wird das Anwachsen von Kleinstlebewesen (Pilzen, Algen u.ä.) verhindert, wodurch Schiffe theoretisch bis zu 40 Prozent Kraftstoff einsparen können. Die biozide Wirkung macht man sich auch beim Einsatz als vorbeugendes Holzschutzmittel zu Nutze.
Gleichzeitig ist Kupfer auch ein essentielles Spurenelement. Erwachsene Menschen benötigen tägliche ca. 1–1,5 Milligramm des Materials. Wir nehmen es durch kupferhaltige Lebensmittel, wie bspw. Schokolade, Leber, Getreide, Gemüse und Nüssen auf.
Nano-Kupfer

Auftragen von Holzschutz ©Osterland/Fotolia.com
Als Nanomaterial wird Kupfer vor allem als Biozid und für elektrische Anwendungen eingesetzt. In der Informations- und Kommunikationstechnologie werden vermehrt kleine, präzise Schalt- und Leiterbahnen benötigt. Hierbei helfen bspw. Lösungen oder Pasten aus Kupfer-Nanopartikeln, die mittels neuartiger Druckverfahren gezielt aufgebracht werden können.
Antifouling-Beschichtungen für Schiffsrümpfe gelten ebenfalls als Anwendungsgebiet für Kupfer-Nanopartikel, jedoch kann hier derzeit kein Produkt identifiziert werden, welches die Angabe machte, derartige Partikel als Biozid zu verwenden.
Anders im Bereich der Biozide für die Holzimprägnierung. Der Holzschutz wird durch den Einsatz von Kupfer-Nanopartikeln in Bioziden deutlich verbessert, die Lebensdauer von Holzkonstruktionen maßgeblich verlängert und somit die Kosten für den Endverbraucher reduziert. Wässerige Formulierungen aus Kupfer-Nano- und Mikro-Partikeln in der Größenordnung von 1 nm bis 25 μm werden seit einigen Jahren kommerziell im Holzschutz eingesetzt. Den Verbrauch von Kupfer-Nanopartikeln für diese Branche schätzen Experten auf mehrere tausend Tonnen pro Jahr. Damit besitzen derartige Holzschutzmittel das Potential, eine der größten Nano-Anwendungen in Europa für schwer tränkbare Holzarten wie Rotfichte (Picea abies) und Weißtanne (Abies alba) zu werden.
Metallisches Nanokupfer ist selbstentzündlich. Die Mischung von Nanokupfer mit Luft (Staub) ist auch ohne Einwirkung einer Zündquelle entzündlich. Im Gegensatz dazu ist nanoskaliges Pulver aus Kupferoxid nicht selbstentzündlich. Kupferoxid-Staub ebenso wenig, also besteht beim Kupferoxid keine Möglichkeit einer Staubexplosion .
Vorkommen und Herstellung
2011 wurden über 16 Millionen Tonnen Kupfer aus Erzminen gewonnen, allein 5,3 Millionen Tonnen in Chile, dem derzeit größten Kupferproduzenten der Welt. Kupfer ist zudem äußerst gut zu recyceln, so dass auch ein großer Teil des weltweiten Bedarfs durch sog. Sekundär-Kupfer gedeckt wird.
Kupfer-Nanopartikel können über nasschemische Verfahren oder mittels Flammensynthese hergestellt werden. Bei der nasschemischen Variante werden Kupfersalze, bspw. Kupfersulfat in Anwesenheit eines Stabilisator (Polymere, Aminverbindungen, etc.) zu Nanopartikeln reduziert. Dadurch enthält man kolloidale Lösungen der Nanopartikel, die direkt weiterverarbeitet werden können. Bei der Flammensynthese werden unter stark reduzierenden Bedingungen kupferhaltige Verbindungen verbrannt und so Kupfer-Nanopartikel erhalten. Hier besteht die Möglichkeit, unterschiedliche metallhaltige Verbindungen zu verbrennen, wodurch hybride Metallpartikel (Legierungen) erhalten werden können.
Weitere Informationen
- Wikipedia (DE): Kupfer
- Waterman, BT et al. (2010).Texte Nr. 40/2010:"Einsatz von Nanomaterialien als Alternative zu biozidhaltigen Antifouling-Anstrichen und deren Umweltauswirkungen", Umweltbundesamt, ISSN 1862-4804.
Gewinnung

Der Bingham-Kupfer-Tagebau @Allen-stock.adobe.com
Kupfer wird hauptsächlich im Tagebau gewonnen, geringere Anteile werden Untertage gefördert. Die Hauptförderländer sind Chile, Peru und China. Der Gehalt an Kupfer in den geförderten Erzen ist generell sehr gering, daher ist der Aufwand für die Anreicherung hoch und ressourcenintensiv.
Da Kupfer sowohl in Elektrokabeln als auch als Kathodenmaterial in Batterien (z.B. Fahrzeugbatterien) Anwendung findet, wird mit einem ständig steigenden Bedarf durch den Ausbau erneuerbarer Energien (z.B. Off-shore Windparks) und der Elektromobilität gerechnet.
Ressourcenverbrauch bei Aufbereitung
Da die Erze nur einen sehr geringen Kupferanteil zwischen 0,6 – 0,7 % haben, ist der Ressourcenverbrauch bis Kupfer in reiner Form vorliegt, enorm. Da der Hauptteil der Kupfererze im Tagebau abgebaut wird, ist der Flächenverbrauch hoch. Zudem entsteht viel Abraum, der ebenfalls auf Halden gelagert wird und Flächen verbraucht. Zum Herauslösen des Kupfers aus dem Erz wird viel Wasser benötigt, welches zusätzlich mit Chemikalien versetzt wird. Ein Teil des Wassers kann rückgewonnen und wiederverwendet werden, die Lagerung des Restwassers erfolgt in Absetzbecken. Die Verhüttung der Kupfererze bei hohen Temperaturen verbraucht zudem viel Energie.
Sicherheit
Kupfer ist für einige Lebewesen ein essentielles Element. Dennoch können zu hohe Konzentrationen schädlich wirken. So kann das Einatmen von Kupfer-haltigem Staub beim Menschen zu Lungenreizungen führen. Wie bei anderen Stäuben auch sind hier die kleinen, lungengängigen Partikel besonders kritisch. Das ist insbesondere für den Tagebau relevant, der häufig in sehr trockenen Gegenden stattfindet, was eine hohe Staubbelastung begünstigt. Die Stäube enthalten neben Kupfer häufig auch andere Schwermetalle, die giftig für Mensch und Umwelt sind. Kupfer ist sehr giftig für Wasserorganismen sowohl bei kurzzeitiger als auch bei langfristiger Exposition.
Auch die Abwässer der Kupferförderung enthalten meist weitere giftige Schwermetalle (z.B. Blei) und Halbmetalle (z.B. Arsen), die die Umwelt belasten.
Emissionen
Bei der Förderung und weiteren Verarbeitung von Kupfer wird viel CO2 freigesetzt. Die CO2-Emissionen fallen während der Förderung (Treibstoff für Maschinen), während der Weiterverarbeitung des Erzes und der Verhüttung, sowie für den Transport an. Bei der Verhüttung entsteht auch Schwefeldioxid, dessen Emissionen mit Filtern weitestgehend aufgefangen und zu Schwefelsäure weiterverarbeitet werden.
Bei der Förderung entsteht Abraum, der meist im Umfeld der Förderstellen auf Halden abgelagert wird. Es wird geschätzt, dass pro Tonne Kupfer ca. 570 t an verschiedenen Rückständen anfallen. Beim Waschen des Erzes entsteht zudem mit Prozesschemikalien und Schwermetallen belastetes Wasser. In einigen Abbauregionen wird das Wasser in Flüsse eingeleitet und verursacht Fischsterben.
Soziale Aspekte
Die Kupferförderung bietet häufig gute Einkommensmöglichkeiten auch in entlegenen Gebieten, und führt zur Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen in anderen Branchen. Konflikte treten vor allem in Ländern mit schwacher Regierungsführung auf und betreffen die gerechte Bezahlung, Arbeitsbedingungen sowie den Arbeitsschutz. In einigen Regionen treten Konflikte mit der lokalen Bevölkerung bezüglich Land- und Wassernutzung oder auch Umsiedlungen auf.
Die unternehmerische Konzentration bei der Kupferförderung wird als gering eingestuft. Das ist vorteilhaft, da so nicht nur wenige Unternehmen profitieren. Die Wertschöpfung bei Bergbau und Aufbereitung des Erzes ist gut, so dass die entsprechenden Länder profitieren, auch wenn keine Weiterverarbeitung des Kupfers im Land stattfindet.
Das gewichtete Länderrisiko für die Förderländer, in welches die Indikatoren der Weltbank eingehen (Worldwide Governance Indicators[DKd2] ) zeigt ein mittleres Risiko an. Das bedeutet, dass in Punkten wie z.B. politischer Stabilität, Mitspracherecht und Korruptionsbekämpfung in einigen Förderländern Verbesserungsbedarf besteht.
Für eine verantwortungsvolle Metall-Produktion gewinnt die Sorgfaltspflicht in den Lieferketten in der EU zunehmend an Bedeutung. Das Gesetz schreibt die Dokumentation oder Zertifizierung von Sozialstandards und Arbeitsschutz vor, zunächst aller-dings nur für Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten. Es gibt zahlreiche Initiativen (z.B. für Zertifizierungen), um die sozialen und ökologischen Bedingungen und damit die Nachhaltigkeit im Kupferbergbau zu verbessern.
Entsorgung und Recycling
Kupfer kann nahezu unendlich oft ohne Qualitätsverlust recycelt werden. Dabei wird zwischen sortenreinen Schrott, der einfach eingeschmolzen und wieder verarbeitet werden kann, und Altschrott unterschieden, der auch andere Materialien enthalten und aus dem Kupfer mit aufwändigen Prozessen wieder herausgelöst werden muss. Der Anteil an Sekundärkupfer aus Recyclingprozessen beträgt weltweit ca. 17 %, in Deutschland 41 %. Generell wird jedoch geschätzt, dass für recyceltes Kupfer je nach Art der Aufbereitung 30-80 % weniger Energie als für die Neuförderung benötigt wird.
Für Batterien gibt es gesetzliche Vorgaben für Recyclingraten. Die Europäische Batterieverordnung legt für Kupfer eine Recyclingrate von 90% im Jahr 2027 fest (siehe auch https://www.batteriegesetz.de/themen/die-neue-batterieverordnung-batt2-2022/).
Wie lässt sich das Material nachhaltiger gestalten?
Bei den Hauptanwendungen (z.B. Stromkabel, Leiterplatten) ist eine Substitution nur schwer möglich, teilweise kann Kupfer in elektrischen Anwendungen durch Aluminium ersetzt werden. Die Recyclingrate bzw. die Recyclingprozesse lassen sich verbessern, insbesondere für Altschrotte. Kupfer ist jedoch gut verfügbar und noch viele neue Abbaustätten können erschlossen werden, was die Motivation für Recycling reduziert.
Weiterführende Informationen:
- Rohstoffwirtschaftliche Steckbriefe Kupfer, https://www.deutsche-rohstoffagentur.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/Informationen_Nachhaltigkeit/kupfer%202021.pdf?__blob=publicationFile&v=3
- Kupfer – Informationen zur Nachhaltigkeit, https://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/Informationen_Nachhaltigkeit/kupfer.pdf?__blob=publicationFile
Studien zu Kupfer und Kupferoxid Partikeln zeigen eine toxische Reaktion aufgrund der Freigabe von Kupfer-Ionen. Hohe Dosen können verschiedene Störungen in Leber, Niere oder neuronalen Funktionen aufgrund der freigesetzten Kupfer-Ionen verursachen.
Untersuchungen am lebenden Organismus - in vivo
Nach oraler Verabreichung von Kupferpartikeln an Mäuse konnten größenabhängige Effekte beschrieben werden. Dabei wurden Mikropartikel als nicht-toxisch klassifiziert (LD50 > 5000 mg/kg). Im Gegensatz dazu wurde der nanoskaligen Form eine gemässigte Toxizität (LD50 von ca. 400 mg/kg) nach der Hodge und Sterner Skala zugeordnet. Mäuse, welchen mittels Sondenfütterung 70 mg Kupfer Nano- oder Mikropartikel pro kg Körpergewicht verabreicht wurden, zeigten nur nach Einnahme von nanoskaligen Kupferpartikeln eine Akkumulation von Blut-pH erhöhenden Stoffen und Kupfer-Ionen, welche sogar eine Alkalose auslösten, vergleichbar nach der Fütterung der entsprechenden Menge Kupferchlorid-Salz (147,6 mg/kg) .
An einem weiteren Versuch an Ratten konnte via Urin, Blutserum, Leber- und Nierenextrakten gezeigt werden, dass bei der höchsten Menge von 200 mg Kupfer Nanopartikeln pro kg Körpergewicht täglich über 5 Tage verabreicht, diese schwere Leber- und Nierenschäden auslösen können, ähnlich wie eine Kupfer-Ionen Überdosis . Es wird spekuliert, dass die Nierenschädigung bei hohen Dosen von Kupfer Nanopartikeln (bis zu 600 mg/kg Körpergewicht) mit oxidativen Stress und damit einhergehendem Zelltod (Apoptose) verbunden ist .
Bei der Inhalation (4 Stunden/Tag, 5 Tage die Woche für 2 Wochen mit 3.5 mg/m3) und Instillation (24 Stunden post - Exposition von 3 µg, 35µg und 100 µg pro Maus) an Mäusen, wurden Entzündungsreaktionen und Einwandern von Neutrophilen beobachtet. Nach gleichzeitiger Exposition der Lunge mit Klebsiella pneumoniae, einem Bakterium der Mundflora und des Magen-Darm-Traktes, und Kupfer Nanopartikeln konnte beobachtet werden, dass die Anwesenheit von Kupfer Nanopartikeln den natürlichen Reinigungsmechanismus der Lunge behindert .
Nach intranasaler Instillation von Kupfer Nanopartikeln in Mäusen konnten neben der Schädigung der direkt exponierten Gewebe auch systemische Effekte beobachtet werden. Eine Dosis von 40 mg Kupfer Nanopartikeln pro kg Körpergewicht löste signifikante Veränderungen in der Menge von Botenstoffen in verschiedenen Gehirnregionen aus, ohne dass Partikel oder erhöhte Konzentration von Kupfer-Ionen vor Ort gefunden werden konnten. Dies ist ein Hinweis auf eine systemische Wirkung .
Alle beobachteten Effekte ausgelöst durch Kupfer und Kupferoxid Nanopartikel können wie folgt zusammengefasst werden: Die Partikelgrösse bestimmt die Verteilung im Körper und die Freisetzung der Kupfer-Ionen, wobei die Wirkung allerdings direkt vergleichbar mit der von gelösten Kupfer-Ionen ist.
Untersuchung außerhalb des Körpers – in vitro
Untersuchungen von Kupfer- und Kupferoxid-Partikeln haben gezeigt, dass diese Partikel wie andere auch, in Zellkulturmedium die Tendenz haben, schnell zu agglomerieren. Diese Agglomerate werden in Vesikel -ähnlichen Strukturen von verschiedenen Zelltypen aufgenommen. Freie, in der Zelle (Zytosol) vorkommende Partikel wurden nicht beschrieben.
Nicht-beschichtete Cu- und CuO-Nanopartikel sind in einer wässrigen Umgebung löslich und setzen Kupfer-Ionen frei. Eine Dosis -abhängige Toxizität, welche zwischen 1–80µg/ml beobachtet wurde, konnte in verschiedenen unabhängigen Studien bestätigt werden. Zusätzlich ergab eine Genexpressionstudie, durchgeführt mit 25µg/ml CuO-NP (Agglomerate von 300nm mit primärer Partikelgrösse von 50nm) an der menschlichen Lungenkrebszelllinie A549, eine Aktivierung von Stressantwortgenen und des Stoffwechsels aber auch eine Hemmung von zellulären Prozessen, inklusive spezifischen Genen, die den Zellzyklus kontrollieren. Zur Kontrolle wurde der Überstand des Zellkulturmediums, aus dem die CuO-Nanopartikel entfernt wurden, mitanalysiert. Die meisten beschriebenen Effekte konnten damit auch erzielt werden, was darauf hinweist, dass die gelösten Kupfer-Ionen für die biologischen Effekte verantwortlich sind und weniger die partikuläre Form .
Im Vergleich zu anderen nanoskaligen Metalloxiden wie TiO2, ZnO, Fe3O4, Fe2O3 oder Kohlenstoff-basierten Materialien z.B. Kohlenstoff-Nanoröhrchen, lösen nicht-beschichtete Kupfer- und Kupferoxid-Partikel bei gleicher Konzentration immer schwerwiegendere toxische Effekte in den getesteten Zellen aus.
Einige Studien haben speziell große (im Mikrometer Bereich) und nanoskalige CuO Partikel in verschiedenen zellulären Systemen wie A549 (Lungenkrebszelllinie), HeLa (Gebärmutterhals-Krebszelllinie) oder CHO (unreife Chinesische Hamster Eizellen), CaCo-2 (Darmkrebs-Zelllinie) verglichen und kamen zum Schluss, dass die nanoskalige Form von CuO aufgrund der höheren Freisetzung von Kupfer-Ionen im Vergleich zu den Mikropartikeln immer eine höhere Toxizität ausgelöst hat.
Über eine mögliche Exposition der Umwelt mit Kupfer- und Kupferoxid-Nanopartikeln liegen keine Daten vor. Generell sind Kupfer und Kupferverbindungen natürlicherweise in Böden und Gewässern vorhanden.
Mit Hilfe von Computermodellen hat eine Studie berechnet, dass Umweltkonzentrationen von 0,06 mg/l Kupfernanopartikel in taiwanesischen Flüssen auftreten könnten .
Nach Inhalation oder Instillation von nicht-beschichteten Kupfer- und Kupferoxid Nanopartikeln wurde bis heute kein Übertritt in die Blutbahn beschrieben. Nach oraler Verabreichung wurde ein erhöhter Wert von Kupfer-Ionen in Leber und Niere nachgewiesen.
Aufnahme über die Lunge – Inhalation
Die Bestimmung der Translokationsrate von löslichen Materialien z.B. durch die Luft-Blut Barriere, ist nicht einfach zu bestimmen, denn die Partikel können bereits vor dem Zeitpunkt der Analyse gelöst sein. Dennoch, wie von Zhang und Mitarbeitern gezeigt, kann ein erhöhter Wert von Kupfer-Ionen in Leber, Lunge oder olfaktorischem Nerv nach Verabreichung von 40mg Kupfer Nanopartikeln pro kg Körpergewicht in Mäusen nachgewiesen werden. Dies deutet darauf hin, dass zumindest Kupfer-Ionen in der Lage sind, die Barriere zu überwinden .
Aufnahme über den Magen-Darm-Trakt
Der Nachweis der Partikel im Gewebe ist aufgrund der hohen Löslichkeit der Partikel noch nicht erbracht. Leber- oder Nierenschäden wurden nur nach Verabreichung hoher Dosen beobachtet und konnten den freigesetzten Kupfer-Ionen zugeschrieben werden .
Es liegen zahlreiche Studien zur Wirkung von Kupfer- und Kupferoxid- Nanopartikeln auf Umweltorganismen vor. Die meisten berücksichtigen die Wirkung löslicher Kupferionen und/oder vergleichen die Effekte von nanoskaligen mit den gröberer Partikel. Einige Studien berichten von einer höheren Toxizität der Nanopartikel im Vergleich zu gelöstem ionischen Kupfer. In vielen Untersuchungen konnten jedoch keine Unterschiede in den Effekten festgestellt werden. Kupfer zählt zu den bekanntermaßen ökotoxischen Stoffen, so wurden Kupferverbindungen lange Zeit in Anstrichen für Schiffsrümpfe eingesetzt, um den Bewuchs mit Algen, Muscheln und Schnecken zu unterbinden.
Kupfer- und Kupferoxid-Nanopartikel wurden hinsichtlich ihrer Wirkung auf unterschiedliche Organismen mit verschiedenen Lebensräumen untersucht. CuO Nanopartikel sind toxisch für Bakterien . Für die Effekte verantwortlich sind jedoch Kupferionen, die sich aus den Partikeln lösen und mit der „Schutzhülle“ der Bakterien interagieren. Sie lösen oxidativen Stress aus. In Gegenwart von Substanzen, welche die Kupferionen „wegfangen“ (sogenannte Chelatoren), konnten keine toxischen Effekte beobachtet werden. Erstaunlicherweise unterschieden sich jedoch die toxischen Effekte je nach Herkunft der Ionen: aus Partikeln stammende Ionen wirken anders als die aus Kupfersalzen stammende Ionen. Gröbere Partikel setzten nur sehr wenige Ionen frei und waren nicht toxisch
Der EinzellerTetrahymenareagierte auf verschiedene Kupfer-Verbindungen mit einer Veränderung der Zusammensetzung seiner Fett-Bestandteile . Bei vergleichbarer Toxizität setzte nano-CuO weniger Ionen frei als Kupfersalze oder gröbere Kupferpartikel, so dass hier ein zusätzlicher Effekt durch die Nano-Form angenommen wird.
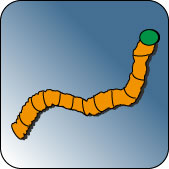 Die Wirkung von Kupfer-Nanopartikeln auf bodenbewohnende Würmer wurde getestet, indem die Partikel in den Boden gemischt wurden. Je nach Wurm-Art wurden gegensätzliche Ergebnisse erzielt. Kupfer-Nanopartikel wirkten hemmend auf die Fortpflanzung der Würmer, jedoch war Kupfersalz in gleichen Mengen verabreicht in einer Studie toxischer als die Partikel und in einer anderen Studie weniger toxisch bzw. von gleicher Toxizität. Die Wirkung von Cu-Nanopartikeln und Cu-Salzen auf die Genaktivierung der Würmer führte zu sehr verschiedenen Antwort-Mustern, was zu der Vermutung führt, dass die Cu-Nanopartikel eine spezifische Wirkung hervorrufen, die mit der der Cu-Ionen nicht vergleichbar ist .
Die Wirkung von Kupfer-Nanopartikeln auf bodenbewohnende Würmer wurde getestet, indem die Partikel in den Boden gemischt wurden. Je nach Wurm-Art wurden gegensätzliche Ergebnisse erzielt. Kupfer-Nanopartikel wirkten hemmend auf die Fortpflanzung der Würmer, jedoch war Kupfersalz in gleichen Mengen verabreicht in einer Studie toxischer als die Partikel und in einer anderen Studie weniger toxisch bzw. von gleicher Toxizität. Die Wirkung von Cu-Nanopartikeln und Cu-Salzen auf die Genaktivierung der Würmer führte zu sehr verschiedenen Antwort-Mustern, was zu der Vermutung führt, dass die Cu-Nanopartikel eine spezifische Wirkung hervorrufen, die mit der der Cu-Ionen nicht vergleichbar ist .
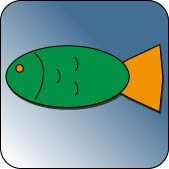 Studien an Zebrabärblingen kommen zu demselben Schluss, hier trat zusätzlich eine Schädigung der Kiemen auf. Kupferoxid-Nanopartikel waren für Zebrabärblinge weniger toxisch als Kupfersalze. Karpfen zeigten eine Wachstumsverzögerung nach Exposition mit nano-Kupferoxid, ebenso wurde eine Partikelaufnahme in verschiedenen Organen nachgewiesen .
Studien an Zebrabärblingen kommen zu demselben Schluss, hier trat zusätzlich eine Schädigung der Kiemen auf. Kupferoxid-Nanopartikel waren für Zebrabärblinge weniger toxisch als Kupfersalze. Karpfen zeigten eine Wachstumsverzögerung nach Exposition mit nano-Kupferoxid, ebenso wurde eine Partikelaufnahme in verschiedenen Organen nachgewiesen .
 CuO Nanopartikel stören die Entwicklung von Krallenfrosch-Embryonen. Die Hauptaufnahme-Route war das Verschlucken der Partikel. Folglich waren Schäden im Magen-Darm-Trakt zu beobachten, welche sowohl auf die partikuläre Form als auch die Ionen zurückzuführen waren. Eine elektronenmikroskopische Studie an Wasserflöhen zeigte eine Aufnahme von CuO-Partikeln (nano und mikro) in den Darm der Tiere, jedoch wurde für beide Partikel keine Aufnahme aus dem Darm in den Körper beobachtet. Wasserflöhe zeigten eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Nanopartikeln verglichen mit gröberen Partikeln oder Salzen .
CuO Nanopartikel stören die Entwicklung von Krallenfrosch-Embryonen. Die Hauptaufnahme-Route war das Verschlucken der Partikel. Folglich waren Schäden im Magen-Darm-Trakt zu beobachten, welche sowohl auf die partikuläre Form als auch die Ionen zurückzuführen waren. Eine elektronenmikroskopische Studie an Wasserflöhen zeigte eine Aufnahme von CuO-Partikeln (nano und mikro) in den Darm der Tiere, jedoch wurde für beide Partikel keine Aufnahme aus dem Darm in den Körper beobachtet. Wasserflöhe zeigten eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Nanopartikeln verglichen mit gröberen Partikeln oder Salzen .
 Eine bodenbewohnende Wasserschnecke nahm mehr Kupfer aus nano-Kupferoxid im Vergleich zu gröberem Kupferoxid und Kupfersalzen auf . Dementsprechend hatte nanoskaliges Kupferoxid die größten Effekte auf Wachstum, Futteraufnahme und Fortpflanzung der Tiere .
Eine bodenbewohnende Wasserschnecke nahm mehr Kupfer aus nano-Kupferoxid im Vergleich zu gröberem Kupferoxid und Kupfersalzen auf . Dementsprechend hatte nanoskaliges Kupferoxid die größten Effekte auf Wachstum, Futteraufnahme und Fortpflanzung der Tiere .
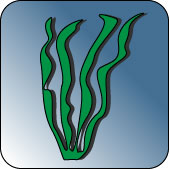 Kupferoxid-Partikel wirkten toxisch auf Grünalgen. Um das Herauslösen von Cu-Ionen zu verhindern, wurden CuO-Partikel mit einem Polymer beschichtet. Diese Partikel wiesen jedoch eine höhere Toxizität auf. Vermutlich erhöht die Beschichtung eine Partikel-Aufnahme in die Zellen. Ähnliche Ergebnisse wurden an Blaualgen erzielt, welche in Gegenwart von organischen Materialien mehr Partikel aufnahmen. Für verschiedene Wasserorganismen (Algen, Krebse, Rotiferen) waren CuO Partikel weniger toxisch als Kupfersalze, aus den in dieser Studie verwendeten Partikeln wurde kein Herauslösen von Ionen beobachtet .
Kupferoxid-Partikel wirkten toxisch auf Grünalgen. Um das Herauslösen von Cu-Ionen zu verhindern, wurden CuO-Partikel mit einem Polymer beschichtet. Diese Partikel wiesen jedoch eine höhere Toxizität auf. Vermutlich erhöht die Beschichtung eine Partikel-Aufnahme in die Zellen. Ähnliche Ergebnisse wurden an Blaualgen erzielt, welche in Gegenwart von organischen Materialien mehr Partikel aufnahmen. Für verschiedene Wasserorganismen (Algen, Krebse, Rotiferen) waren CuO Partikel weniger toxisch als Kupfersalze, aus den in dieser Studie verwendeten Partikeln wurde kein Herauslösen von Ionen beobachtet .
Verschiedene Pflanzenarten (Rettich, Weidelgras und Wasserlinse) waren übereinstimmend in ihrem Wachstum gehemmt. In Rettich und Weidelgräsern wurden zusätzlich DNA-Schädigungen beobachtet. Obwohl die Kupferaufnahme in Pflanzen höher war, wenn das Kupfer als Ion vorlag, traten nach Nanopartikel-Exposition mehr Schäden im Erbgut auf. Die Wasserlinse nahm mehr Kupfer auf, wenn es in partikulärer Form vorlag. Mais-Pflanzen zeigten eine durch CuO-NP ausgelöste Wachstumsverzögerung, nicht jedoch durch Cu-Salze oder gröbere Partikel. Eine Partikelaufnahme über die Wurzel und die Verteilung in der Pflanze wurde nachgewiesen. Es wurden große Unterschiede in der Empfindlichkeit der einzelnen Pflanzenarten beobachtet .
Zusammenfassend wirkt das in bestimmten Dosen bekanntermaßen toxische Kupfer auch in der Nano-Form toxisch. Es lässt sich aus den vorhandenen Studien keine allgemeine Aussage dazu treffen, ob die Wirkung allein auf den Ionen oder der Partikel-Form beruht. Die beobachteten Effekte sind jedoch zum Teil der Wirkung der sich herauslösenden Kupferionen zuzuschreiben, und Kupfer kann prinzipiell von vielen Organismen aufgenommen werden. Zwischen den beiden Partikelarten CuO und Cu bestehen keine auffälligen Unterschiede hinsichtlich der Wirkung auf Organismen und es gibt keine Unterschiede hinsichtlich der Löslichkeit.
Derzeit gibt es keinen eindeutigen Beweis, dass Kupfer- oder Kupferoxid-Partikel biologische Barrieren durchqueren können. Sie können von verschiedenen Zelltypen aufgenommen werden.
Verhalten an Gewebeschranken
In zwei Ingestionsstudien (engl. ingestion, Verabreichung über die Nahrungszufuhr) sowie einer Inhalationsstudie konnten eine Erhöhung von Kupfer-Ionen in verschiedenen Organen nachgewiesen werden. Die dabei verwendeten analytischen Methoden können nicht immer zwischen gelöstem oder partikulärem Kupfer unterscheiden. Das ist eine generelle Schwierigkeit für leicht lösliche Nanopartikel .
Aufnahmeverhalten in Zellen
Sie werden in vesikulären oder lysosomalen Strukturen eingelagert. Nicht-beschichtete Partikel haben eine hohe Wahrscheinlichkeit in diesen Organellen aufgelöst zu werden und dabei lokal sehr hohe Kupfer-Ionen Konzentrationen oder die Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) zu erzeugen .
Insgesamt liegen sehr wenige Daten zum Umweltverhalten von Kupfer- und Kupferoxid-Partikeln vor. In einer Vergleichsstudie mit mehreren Nanomaterialien war nanoskaliges Kupferoxid in künstlichen Böden relativ gut mobil.
Hohe Salzkonzentrationen führten zu einer Verringerung der Beweglichkeit, während in Gegenwart von Huminsäuren eine leichte Erhöhung zu beobachten war. Aus den verwendeten Kupferoxid-Nanopartikeln lösten sich wenig Ionen .
 >
>